Montag, 10. Dezember 2007
Deutschland, Deutschland....
Hamburg, 4.00 Uhr, die Frisur sitzt zwar nicht, aber dennoch fahre ich durch eine morbide Szene aus Nebelniesel, der Konturen und Scheinwerferlicht so diffus bricht, daß ich mit geschlossenen Augen vermutlich entspannter durch die Stadt gekommen wäre.
Nachtaktiv ist nur die beige Mercedes-Flotte mit den penetrant leuchtenden gelben Schildern auf dem Dach – selbst die blenden jetzt. Es ist, als ob in einer Parallelwelt eine andere Spezies herrschen würde.
Ich geselle mich zu ihnen, da meine halbe Mischpoke ausfliegt – direkt an das andere Ende der Welt, möglichst weit weg von der deutschen allweihnachtlichen materialistischen Materialschlacht.
Die kleinen Kinder scheinen schon in der neuen – also nicht meinen – Zeitzone angekommen zu sein und sind auf morbide Art aufgekratzt und tatendurstig.
Daß ein 26-Stundenflug ansteht, erfassen sie noch nicht in Gänze.
Der nunmehr mit atmenden Warmblütern bewohnte Familien-Van beschlägt jetzt auch von innen; mein innerliches Ächzen verbündet sich heimlich mit dem Stöhnen des Motors – doppelblind geht es weiter durch die Nacht.
Hamburg-Airport; die Terminals sind jedes Mal anders anzufahren, der Moloch lebt und erbaut sich wie eine Amöbe ständig neue Wucherungen, die inzwischen derart ausgeufert sind, daß man immerhin durch das Dunkel direkt delegiert wird – Parkplätze vor den großen Einlassdrehschleusen, die Gepäckstücke, Mann und Maus wie gigantische Turbinen ansaugen.
In der Abflughalle dämpft die enorme Höhe jedes Geräusch – die Schallwellen haben so viel Auslauf, daß sich kaum noch eine an mein Innenohr verirrt. Ich betrete die Trancewelt.
Wie paradox – nun sind wir inmitten von Menschen, aber das Plappern ist ganz sanft und abgepuffert.
Diese Menschen sind undeutsch – so die Lieblingsvokabel einer EX-Freundin, die mich so titulierte, als wir 1999 um Kochs Antiausländerkampagne stritten.
Ich habe auch keinen deutschen Pass – fühle mich aber deutsch. SIE fand mich hingegen „undeutsch“; ein Wort, das ich nie recht begriff.
Aber hier im Terminal 2 am First-Class-Check-in ist es tatsächlich undeutsch und selbst die Durchsagen, die anderenorts dazu führten, daß ich Pipe-down beitreten musste, klingen hier angenehm säuselnd.
Ich fühle mich wie in der Zukunft: GATTACA-artig lullen mich unglaublich sanfte bemüht menschliche Computerstimmen ein. Was bei Orwell als Grauen prognostiziert wurde, manifestiert sich hier seelenstreichelnd: Nachts auf dem Flughafen ist es wie in Abrahams Schoß.
Menschlich bin ich aber immer noch – wie mir mein immer lauter knurrender Magen verrät. Welch unangebrachte Ruhestörung der primitiven biologischen Art! Ich beame mich im Geiste nach unten zum Ankunftterminal – dort gibt es für die wartenden Verlorenen Nahrung.
Immer stärker wird der Sog nach unten; ich male mir ein frisches mit Salat und Tomaten belegtes Käse-Baguette aus wie reinstes Manna.
Leider sind die Damen am Check-Counter nicht die flottesten und es dauert und dauert.
So viele Kinder, Karren, Koffer, Knäule von Bettdecken und Taschen sind zu verstauen und durch diverse Nationen zu buchen, daß der Überblick schwer zu behalten ist. Erst um 6.45 Uhr ist es endlich geschafft und eigenartig abrupt werde ich aus dem Familienmodus in den Hungermodus geschleudert.
Ein kurzer Wink und ich verschwinde durch die immer mehr anschwellenden Körperströme gen Ausgang.
Die Durchsagestimmen werden schriller, die Menschen hässlicher, die Töne schärfer. Begleitet von einem gewaltigen Entgegenknurren meines Magens schlüpfe ich in einen futuristischen Glaskubus, der mich in die Unterwelt hinabsenkt.
Ich drücke Knöpfe, rüttele und springe aus dem Lift, laufe zum Bistrostand.
Und dort liegen sie – die Manifestationen meiner Träume: Knackige Baguettebrötchen in allen Variationen, Ich sehe Romanablätter, Endivien und Rucula-Blätter.
Nach fast drei Stunden in einer schwebenden Langsamkeit werde ich rasend hungrig – ungeduldig.
Der Typ, der hinter der Theke steht, guckt mich gelangweilt an, trinkt einen Kaffee. Er ist nur eine ausgestreckte Armlänge entfernt – dazwischen ungreifbar eingeglast die Objekte meiner Begierde.
Ich lasse meine Contenance fallen und spreche ihn an . ...“darf ich bitte ein.....“ Er reagiert nicht.
Vielleicht trägt er Innenohrkopfhörer und ist zufällig blind?
Ich drängele, mein Magen rebelliert geradezu und klopfe auf den Tresen.
Er guckt mich wieder an – zeigt mir seine Uhr – 6.53 Uhr.
„IN ZEHN MIUTEN“ Aha.
Kein Verkauf vor 7.00 Uhr. So ist das nun mal hier.
Ich solle in zehn Minuten wieder kommen.
ZEHN Minuten?
Hat der eine Ahnung, wie lange das für einen Verhungernden ist?
Zu lange – und ich weiß ich bin in Deutschland – das einzige westliche Land, das sich konsequent dem Servicegedanken widersetzt.
Zehn Minuten kann ich nicht mehr warten und entkomme der Szenerie mit einem Sprung hinaus in die Nacht.
Hungrig.
Nachtaktiv ist nur die beige Mercedes-Flotte mit den penetrant leuchtenden gelben Schildern auf dem Dach – selbst die blenden jetzt. Es ist, als ob in einer Parallelwelt eine andere Spezies herrschen würde.
Ich geselle mich zu ihnen, da meine halbe Mischpoke ausfliegt – direkt an das andere Ende der Welt, möglichst weit weg von der deutschen allweihnachtlichen materialistischen Materialschlacht.
Die kleinen Kinder scheinen schon in der neuen – also nicht meinen – Zeitzone angekommen zu sein und sind auf morbide Art aufgekratzt und tatendurstig.
Daß ein 26-Stundenflug ansteht, erfassen sie noch nicht in Gänze.
Der nunmehr mit atmenden Warmblütern bewohnte Familien-Van beschlägt jetzt auch von innen; mein innerliches Ächzen verbündet sich heimlich mit dem Stöhnen des Motors – doppelblind geht es weiter durch die Nacht.
Hamburg-Airport; die Terminals sind jedes Mal anders anzufahren, der Moloch lebt und erbaut sich wie eine Amöbe ständig neue Wucherungen, die inzwischen derart ausgeufert sind, daß man immerhin durch das Dunkel direkt delegiert wird – Parkplätze vor den großen Einlassdrehschleusen, die Gepäckstücke, Mann und Maus wie gigantische Turbinen ansaugen.
In der Abflughalle dämpft die enorme Höhe jedes Geräusch – die Schallwellen haben so viel Auslauf, daß sich kaum noch eine an mein Innenohr verirrt. Ich betrete die Trancewelt.
Wie paradox – nun sind wir inmitten von Menschen, aber das Plappern ist ganz sanft und abgepuffert.
Diese Menschen sind undeutsch – so die Lieblingsvokabel einer EX-Freundin, die mich so titulierte, als wir 1999 um Kochs Antiausländerkampagne stritten.
Ich habe auch keinen deutschen Pass – fühle mich aber deutsch. SIE fand mich hingegen „undeutsch“; ein Wort, das ich nie recht begriff.
Aber hier im Terminal 2 am First-Class-Check-in ist es tatsächlich undeutsch und selbst die Durchsagen, die anderenorts dazu führten, daß ich Pipe-down beitreten musste, klingen hier angenehm säuselnd.
Ich fühle mich wie in der Zukunft: GATTACA-artig lullen mich unglaublich sanfte bemüht menschliche Computerstimmen ein. Was bei Orwell als Grauen prognostiziert wurde, manifestiert sich hier seelenstreichelnd: Nachts auf dem Flughafen ist es wie in Abrahams Schoß.
Menschlich bin ich aber immer noch – wie mir mein immer lauter knurrender Magen verrät. Welch unangebrachte Ruhestörung der primitiven biologischen Art! Ich beame mich im Geiste nach unten zum Ankunftterminal – dort gibt es für die wartenden Verlorenen Nahrung.
Immer stärker wird der Sog nach unten; ich male mir ein frisches mit Salat und Tomaten belegtes Käse-Baguette aus wie reinstes Manna.
Leider sind die Damen am Check-Counter nicht die flottesten und es dauert und dauert.
So viele Kinder, Karren, Koffer, Knäule von Bettdecken und Taschen sind zu verstauen und durch diverse Nationen zu buchen, daß der Überblick schwer zu behalten ist. Erst um 6.45 Uhr ist es endlich geschafft und eigenartig abrupt werde ich aus dem Familienmodus in den Hungermodus geschleudert.
Ein kurzer Wink und ich verschwinde durch die immer mehr anschwellenden Körperströme gen Ausgang.
Die Durchsagestimmen werden schriller, die Menschen hässlicher, die Töne schärfer. Begleitet von einem gewaltigen Entgegenknurren meines Magens schlüpfe ich in einen futuristischen Glaskubus, der mich in die Unterwelt hinabsenkt.
Ich drücke Knöpfe, rüttele und springe aus dem Lift, laufe zum Bistrostand.
Und dort liegen sie – die Manifestationen meiner Träume: Knackige Baguettebrötchen in allen Variationen, Ich sehe Romanablätter, Endivien und Rucula-Blätter.
Nach fast drei Stunden in einer schwebenden Langsamkeit werde ich rasend hungrig – ungeduldig.
Der Typ, der hinter der Theke steht, guckt mich gelangweilt an, trinkt einen Kaffee. Er ist nur eine ausgestreckte Armlänge entfernt – dazwischen ungreifbar eingeglast die Objekte meiner Begierde.
Ich lasse meine Contenance fallen und spreche ihn an . ...“darf ich bitte ein.....“ Er reagiert nicht.
Vielleicht trägt er Innenohrkopfhörer und ist zufällig blind?
Ich drängele, mein Magen rebelliert geradezu und klopfe auf den Tresen.
Er guckt mich wieder an – zeigt mir seine Uhr – 6.53 Uhr.
„IN ZEHN MIUTEN“ Aha.
Kein Verkauf vor 7.00 Uhr. So ist das nun mal hier.
Ich solle in zehn Minuten wieder kommen.
ZEHN Minuten?
Hat der eine Ahnung, wie lange das für einen Verhungernden ist?
Zu lange – und ich weiß ich bin in Deutschland – das einzige westliche Land, das sich konsequent dem Servicegedanken widersetzt.
Zehn Minuten kann ich nicht mehr warten und entkomme der Szenerie mit einem Sprung hinaus in die Nacht.
Hungrig.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)








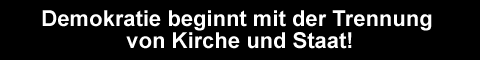



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen